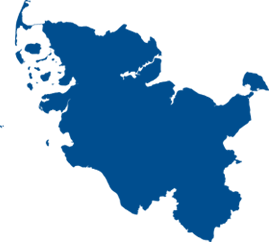Energie
**newmanArticleNotFound**Ansprechpartner
 |
Peter Krey
Dezernent
- Dezernat 2 -
Telefon: 0431/570050-66
e-Mail:
peter.krey@staedteverband-sh.de
Termine
Mitglieder
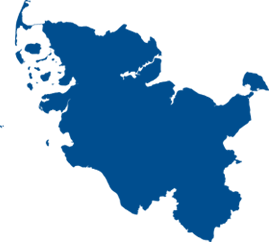
 |
Peter Krey
Dezernent
- Dezernat 2 -
Telefon: 0431/570050-66
e-Mail:
peter.krey@staedteverband-sh.de